FNR Basisdaten Wald und Holz
Die Broschüre enthält die zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren, aktuellsten Daten. Unter basisdaten.fnr.de und in der Mediathek werden die Abbildungen fortlaufend aktualisiert und um neue Themen erweitert. Sie stehen dort für Sie zum kostenlosen Download bereit.
Neue PEFC-Praxishilfen unterstützen Waldbesitzende und Forstleute bei der Umsetzung des PEFC-Standards
Sieben Broschüren mit praxisnahen Empfehlungen zur PEFC-konformen Waldbewirtschaftung veröffentlicht
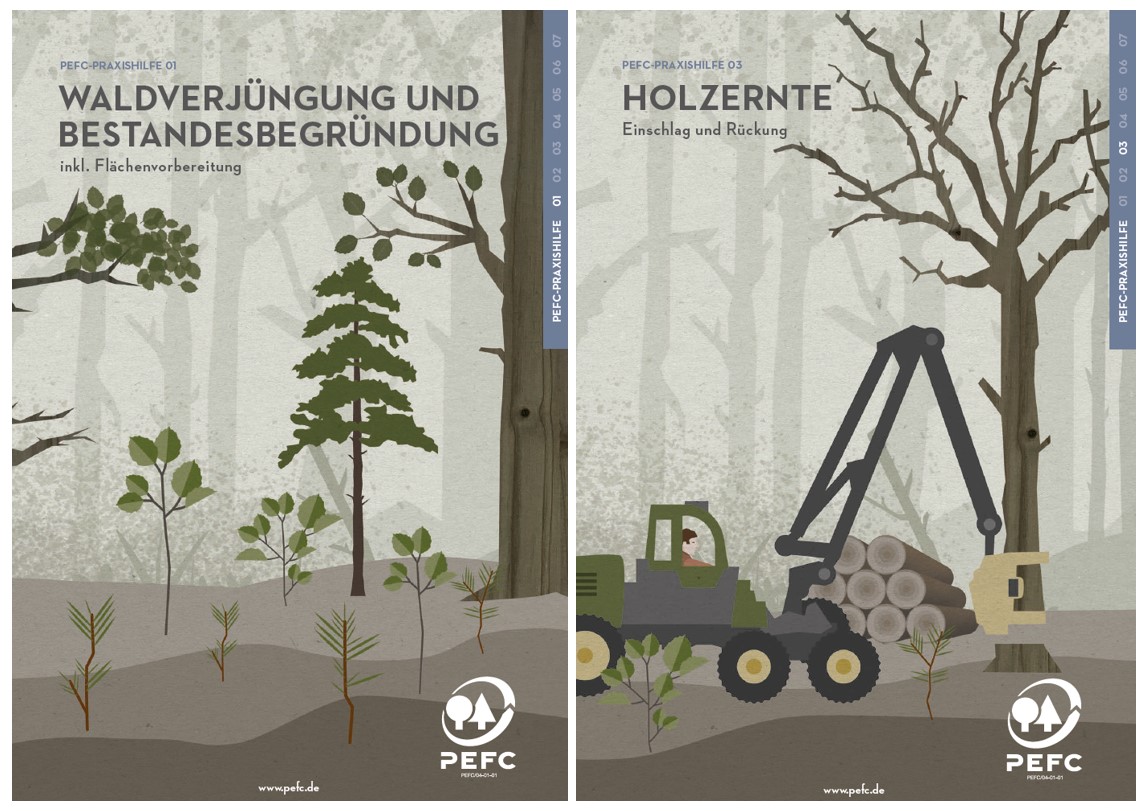
Die PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung sind in ihren Forderungen bereits präzise und praxisorientiert formuliert. Bei der konkreten Anwendung der PEFC-Standards im eigenen Wald können dennoch Fragen auftauchen. Um Waldbesitzende bei der Umsetzung der PEFC-Standards bestmöglich zu unterstützen, wurde bereits das Format „PEFC-Videosprechstunde“ mit vier Live-Sprechstunden pro Jahr eingeführt. Dieses wird nun ergänzt durch sieben neue Broschüren für Waldbesitzende und Forstleute: Die „PEFC-Praxishilfen“ zu den Themen
• Waldverjüngung und Bestandesbegründung
• Waldschutz
• Holzernte
• Private Brennholzwerber
• Natur- und Umweltschutz im Betrieb
• Angepasste Wildbewirtschaftung sowie
• Audits.
Die PEFC-Praxishilfen leisten Hilfestellung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Bewirtschaftungsmaßnahmen, um diese PEFC-konform durchzuführen. Dazu enthalten sie, neben Erläuterungen zum PEFC-Waldstandard, auch Checklisten, Ablaufschemata und Formularvorlagen, die auf freiwilliger Basis genutzt werden können.
So kann etwa die in der Praxishilfe 04 „Private Brennholzwerber“ vorgehaltene „Erklärung zur privaten Brennholzwerbung“, die von Brennholzkundinnen und -kunden ausgefüllt werden kann, direkt beim Forstbetrieb verbleiben – dadurch stellt dieser sicher, dass private Brennholzwerber alle vom PEFC-Standard geforderten Auskünfte über qualifizierte Motorsägenlehrgänge u.ä. abgegeben haben.
Alle Formularvordrucke in den PEFC-Praxishilfen sind auch zusätzlich als digitale Kopiervorlage erhältlich, damit sie in größerer Zahl eingesetzt werden können.
Sie finden alle PEFC-Praxishilfen und die zugehörigen Druckvorlagen hier in einer Übersicht.
Die gedruckten Ausgaben der PEFC-Praxishilfen können ab sofort bei der PEFC-Geschäftsstelle per E-Mail an info@pefc.de vorbestellt werden. Die Abgabemenge ist auf 50 Stück pro Ausgabe pro Bestellung limitiert. Bitte beachten Sie, dass der Versand aufgrund der Vielzahl an eingehenden Bestellungen derzeit einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Lehrfahrt 2023 nach Zusmarshausen
Die diesjährige Lehrfahrt der FBG Ellwangen ging, bei schönstem Wetter, im voll besetzten Reisebus Richtung Augsburg. Aufgrund einer Autobahnsperrung wegen eines Verkehrsunfalles kamen wir etwas zeitverzögert am Treffpunkt in Adelsried an.
Wo wir von Herrn Hubert Droste, Forstbetriebsleiter des bayrischen Staatsforst Zusmarshausen, herzlich empfangen wurden.
Mit dem Bus ging es dann direkt in ein naheliegendes Waldgebiet zu unserem ersten Besichtigungspunkt, einer Versuchsfläche mit Anpflanzung fremdländischer Baumarten. Hier wird erprobt welche Baumarten den hier in Zukunft wachsen können. Türkische Tanne, Atlaszeder, Libanonzeder, Weißtanne und Douglasie werden hier auf ihre Standorteignung erprobt. Es zeigt sich allein schon an der Wuchshöhe, vor allem der Douglasie, welche Baumarten sich hier wohlfühlen und welche doch mit den klimatischen Bedingungen, Bodenverhältnissen und Spätfrösten zu kämpfen haben. Allerdings kann man laut Herr Droste noch keine endgültigen Empfehlungen aussprechen da der Bestand noch zu jung ist.
Der Umbau zu klimaresistenten Wäldern bedarf einen langen Atem und sehr viel Geduld. Welche Baumarten sich in der Zukunft etablieren bleibt auch für Herrn Droste die große Frage. Was sich für ihn bisher gut bewährt hat ist die Douglasie und die Weißtanne im Unterbau sowie als Lichtbaumarten die Stieleiche sowie der Spitzahorn.
Der Umbau von bestehenden Fichten Monokulturen steht auch hier seit vielen Jahren im Vordergrund. Zukünftig sollen Mischwälder mit ca. 3 verschiedenen Hauptbaumarten je Standort das Waldbild prägen. Wichtig ist laut Herr Droste eine gute Bejagung, um die Jungbäume vor Verbiss und Fege Schäden zu schützen.
Weiter ging es mit dem Bus durch die verschiedenen Bestände des Waldgebiets. Durch Einbringen von Unterbau mit Douglasie, Buche und Tanne in gelichteten Beständen ist der angestrebte Umbau zu Mischwäldern und verschiedenen Altersklassen anschaulich zu sehen.
Beim letzten Stopp durften wir die mächtigen Douglasien Bestände des Revieres bestaunen. Bis zu 1000 Vorratsfestmeter auf einen Hektar sind hier zu bestaunen, was bei der Imposanz jedes Einzelbaumes auch nicht verwunderlich ist. Hier hat eine Douglasie schon mal 10 Festmeter. Während im Unterbaum schon wieder Jungbäume heranwachsen erscheint das Waldbild trotzdem licht.
Gegen Mittag ging es dann weiter zum Kloster Oberschönenfeld.
Bevor wir in die Geschichte der Klosterkirche eintauchten, spielte zur Einstimmung unser Mitglied Martin Bauer auf seiner Mundharmonika. Schwester Grazia erzählte lebhaft die interessante Geschichte des Klosters und der Kirche. Mit der Mundharmonika endete die geschichtliche Reise im Kloster und wir wurden schon herzlich zu Mittagessen im Klosterstüble empfangen.
Weiter ging es nach Augsburg wo wir bei einer Stadtführung auf den Spuren der Fugger unterwegs waren und in die Geschichte der Stadt eintauchen durften.
Diesen eindrucksvollen Tag ließen wir bei einer guten Vesper und schönen Melodien im Schwarzen Reiter in Horgau ausklingen.

Wichtiges zur Grundsteuerreform
Siehe FoKa-Info Nr. 16 vom 17.11.2022, Seite 2.
Anpassung von Wäldern und Waldwirtschaft an den Klimawandel
Der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik (WBW) stellte am 08.02.22 seine Kernempfehlungen aus dem Gutachten zur Anpassung von Wäldern und Waldwirtschaft an den Klimawandel vor und diese zur Diskussion. Das Gutachten formuliert in 13 verschiedenen Bereichen der Waldbewirtschaftung und Waldnutzung Handlungsempfehlungen an das Bundesministerium und relevante Entscheidungsträger. Ziel dieser Handlungsempfehlungen ist es, widerstandsfähige und anpassungsfähige Wälder zu fördern und die Leitungsfähigkeit beteiligter Betriebe zu stärken. Neben vielen anderen Themen, die im Gutachten zur Sprache kommen, spielen Maßnahmen zum Schutz des Bodens oder die Förderung nachhaltiger Holzverwendung eine Rolle.
Erfahren Sie hier mehr über das Gutachten und seine Inhalte. Die Vorstellung des Gutachtens ist hier einsehbar: https://www.youtube.com/watch?v=5vSYSY8N8XA
Quelle: FNR
Hinweise zu den aktuellen Entwicklungen am Holzmarkt
Bedingt durch die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen der letzten Wochen hat der Borkenkäferbefall in den Nadelholzbeständen bundesweit wieder stark zugenommen, hält sich im Einzugsgebiet der HVG aber zum Glück noch in Grenzen.
Allerdings trifft das anfallende Käferholz auf einen einbrechenden Schnittholzabsatz und rückläufige Schnittholzpreise bei fast allen Sägewerken. Teilweise wird diese Entwicklung durch steigende Preise im Sägerest- und Energieholz kompensiert, hiervon profitieren allerdings in erster Linie Sägewerke mit einer eigenen Pelletierung.
Steigende Energiepreise und die unsichere weitere Wirtschaftliche Entwicklung treffen nicht nur den Endverbraucher, sondern führen auch bei unseren Kunden zu reduzierten Einschnittmengen, Kaufzurückhaltung und somit zwangsläufig auch zu rückläufigen Rundholzpreisen.
Detaillierte bzw. aktuelle Presseinformationen könne hier heruntergeladen werden.
Bei Fragen zu diesen Themen stehen Ihnen die Revierleiter und die Geschäftsstelle der FSL/HVG zur Verfügung.
Wann ist Energie aus Holz nachhaltig? (Aus: Waldwissen.net)
Der Krieg in der Ukraine verdeutlicht uns gerade schmerzhaft, wie abhängig wir bei der Energiebeschaffung von anderen – meist autokratisch geführten – Ländern geworden sind. Energie aus Holz bietet hierbei eine große Chance: Sie ist regional verfügbar, unter bestimmten Umständen klimaneutral und ist im Gegensatz zu beispielsweise Strom aus Wind oder Photovoltaik, ohne Zwischenspeicher jederzeit abrufbar. Doch wann ist Energie aus Holz nachhaltig und klimaneutral? Das EU-Parlament hat letzte Woche entschieden, dass Biomasse aus Holz weiterhin als erneuerbare Energiequelle gilt. Ausgenommen hiervon ist jedoch Holz aus Erntemaßnahmen, die ausschließlich zur Energiegewinnung durchgeführt werden. Dieses sogenannte Primärholz soll nicht mehr als nachhaltig gelten. Kann man also mit gutem Gewissen mit Holz heizen? Der aktuelle Beitrag Energetische Holzverwendung: Ist die Kritik berechtigt? beantwortet diese Frage ausführlich und geht auch auf die Feinstaubemissionen bei der Holzfeuerung ein.
Forstpflanzen: Versorgungslage Herbst 2022
Aufgrund zahlreicher Anfragen und teilweise bestehender Verunsicherung hinsichtlich der aktuellen Pflanzenverfügbarkeit, hat die EZG (Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen „Süddeutschland“ e.V.)
heuer auch zur Herbstpflanzsaison 2022 eine (etwas vereinfachte) Prognose der Pflanzenverfügbarkeit vorgenommen. Aufgrund des temporär angestiegenen Pflanzenbedarfs, und weil z.B. mangelndes Saatgutaufkommen den „Nachschub“ erschwert, sind einerseits zwar teilweise Engpässe möglich, andererseits ist der
Pflanzenbedarf nicht in allen Regionen so hoch wie prognostiziert und die Baumschulen haben ihre Produktion bereits etwas angepasst. Für viele Baumarten/Herkünfte ist deshalb zum Herbst 2022 zumindest eine
solide Grundversorgung vorhanden.
Die Übersicht über die prognostizierte Verfügbarkeit finden Sie hier.
Schäden an der Douglasie: Forsttrocknis
Infolge ungünstiger Abfolge von Wärme- und Kälteperioden gegen Ende des Winters und zu Beginn der Vegetationszeit sind verbreitet Absterbe-Erscheinungen bei der Douglasie zu beobachten. Dabei ist über große Teile der Krone eine Rötung der Nadeln zu erkennen. Klassische Merkmale, die auf eine Erkrankung oder einen Insektenbefall hindeuten, fehlen meist.
Die Hauptsymptome der physiologischen Nadelröte zeigen sich bei dem aktuellen Schadgeschehen vermehrt in der Oberkrone. Betroffen sind vor allem junge Pflanzen. Diese Nadelröte ist irreversibel und in der Folge nicht selten letal für die Pflanze.
Als Ursache wird davon ausgegangen, dass bei warmen, sonnigen Wintertagen und im frühen Frühjahr bei gefrorenem oder kaltem Boden ein Wasserverlust durch die Transpiration nicht durch die Wasseraufnahme über die Wurzeln ausgeglichen werden kann.
Weitere Informationen über die aktuelle Situation für Südwestdeutschland sowie Maßnahmen und Prognosen finden Sie hier.
Neuer Eichenschädling bestätigt: Eichennetzwanze erreicht Baden-Württemberg
Nach dem ersten Verdachtsfall Anfang August, bestätigt die Abteilung Waldschutz der FVA (Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg), dass die Eichennetzwanze hat Baden-Württemberg erreicht hat. Das bisher dokumentierte Ausbreitungsgebiet verteilt sich auf eine mindestens 20 Kilometer lange Strecke entlang der ICE-Bahnstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe.
Ab dem Frühjahr kann ein Befall durch hellgelb gesprenkelte Bereiche an der Blattunterseite erkannt werden. Im Hochsommer kommt es bei starkem Befall zur Vertrocknung und zu vorzeitigem Blattfall der Eiche. Auch kann es zu Absterbeerscheinungen einzelner Äste kommen. Inwiefern der neue Schädling in Kombination mit bereits vorhandenen Schadorganismen die Gefährdung der Eichen erhöht, wird in der Zukunft bewertet werden.
Die aus Nordamerika und Kanada stammende Eichennetzwanze, erstmals 2000 in Europa nachgewiesen, verbreitet sich seitdem rasant. Die FVA bittet um Meldung von Verdachtsfällen: Waldschutz.FVABW@forst.bwl.de.
Hier finden Sie den Artikel zum Nachlesen.
Borkenkäfer
- Amtlicher Allgemeiner Hinweis zur Überwachung und Bekämpfung von Nadelholz-Borkenkäfern in den Wäldern des Ostalbkreises
Die Untere Forstbehörde im Landratsamt Ostalbkreis weist darauf hin, dass die Waldbesitzenden nach den Bestimmungen des Landeswaldgesetzes (§ 12 LWaldG i.V.m. § 14 Abs. 1 Nrn. 4, 5 LWaldG) verpflichtet sind, zur Abwehr von Waldschäden, insbesondere der Ausbreitung der Nadelholz-Borkenkäfer Buchdrucker (Ips typographus), Kupferstecher (Pityogenes chalcographus), Krummzähniger Tannenborkenkäfer (Pityokteines curvidens) und Kleiner Tannenborkenkäfer (Cryphalus piceae) alle erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. - Die Generationenentwicklung der Buchdrucker ist trotz durchschnittlichem Schwärmbeginn Anfang Mai danach rasch vorangeschritten, mit dem Ergebnis von teilweise 3 Käfergenerationen expositionsabhängig bis in Höhenlagen von etwa 700-800 m ü.NN. Diese Situation gab es so in den letzten beiden Jahrzehnten bisher nur 2 Mal: 2003 und 2018 – jeweils Jahre mit nachfolgenden Massenvermehrungen. Daher ist die konsequente Fortsetzung von Managementmaßnahmen bis in den Herbst hinein dringend geboten, um die hohe Populationsdynamik für das kommende Jahr zu bremsen.
Die Sanierung und Abfuhr des ab sofort erkannten Frischbefalls unterliegt nun aufgrund der beginnenden Winterruhe der Käfer nicht mehr dem extremen Zeitdruck aus dem Sommer. Angestrebt werden sollte trotzdem ein Management so früh wie möglich, spätestens bis etwa Ende Oktober. Anschließend lockert sich die Rinde dicht befallener Fichten zunehmend und das Risiko von großflächigem Rindenabfall passiv oder während der Sanierung steigt. Die Wirksamkeit der Maßnahme würde dann mit den im Bestand verbleibenden Käfern drastisch sinken.
Aktuelle Befallspolter sind unbedingt noch zeitnah abzufahren, denn es ist recht wahrscheinlich, dass sich unter der Rinde relativ weit entwickelte F2-Bruten befinden, welche im Spätsommer noch ausfliegen könnten. - Erkennen, Vorbeugen und Managen von Borkenkäfer sind in der Broschüre der ForstBW oder in der Waldschutz-Info 2/2021 der Forstlichen Versuchs-und Forschungsanstalt Baden-Württemberg beschrieben.
- Borkenkäferbefall auch an Tannen und Lärchen
In Fichtenwäldern verursachen Borkenkäfer wie der Buchdrucker und der Kupferstecher jedes Jahr hohe Schäden. Die rindenbrütenden Käfer an der Weißtanne oder Lärche stehen im Schatten ihrer deutlich bekannteren Verwandten an der Fichte. Der Klimawandel mit seinen vermehrten Wetterextremen spielt aber auch diesen Borkenkäfern in die Karten. Befallene Tannen werden oft erst sehr spät erkannt. Die Anzeichen für Tannenborkenkäferbefall sind nämlich recht unspezifisch: Harzfluss, dürre Kronenäste oder eine fahlgrüne Nadelverfärbung können auch andere Ursachen haben. Der Befall beim Lärchenborkenkäfer unterscheidet sich kaum vom bekannten Buchdrucker an Fichte. Jedoch befällt er gerne auch jüngere Bestände und bei Massenvermehrungen tritt er massiv, aber meist nur kurz in Erscheinung. In zwei neuen Faltblättern hat die LWF die wichtigsten Fakten zu den Borkenkäfern an der Weißtanne und zum Großen Lärchenborkenkäfer knapp und übersichtlich zusammengefasst. Mehr Informationen und die Faltblätter zum kostenlosen Download finden Sie hier. - Siehe auch “Die geheime Sprache der Buchdrucker”:https://www.youtube.com/watch?v=9uIwMrpum4A
Schutz vor Zecken: Damit ein Zeckenstich nicht krank macht
Menschen in den “grünen Berufen” sind besonders gefährdet, von Zecken gestochen zu werden. Die kleinen Spinnentiere übertragen gefährliche Krankheiten. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) rät zur Impfung gegen FSME und informiert über weitere Schutzmaßnahmen. Link: https://www.svlfg.de/zeckenschutz
Notfallplan Wald
Link: https://fbgellwangen.de/wp-content/uploads/2022/11/Notfallplan_Wald.pdf
Forstkammer Baden-Württemberg
Aktuelles von der Forstkammer Baden-Württemberg
